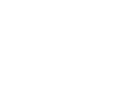Seit 1990 hat sich Schloss Dagstuhl, Leibniz-Zentrum für Informatik, zum Treffpunkt der besten Informatiker der ganzen Welt entwickelt. Das weltweit renommierte Forschungszentrum ist seit 2005 Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und bietet die besten Voraussetzungen für einen intensiven wissenschaftlichen Austausch in romantischer Schlossatmosphäre. Mit der Veranstaltungsreihe „Dagstuhler Gespräche“ möchten das Leibniz-Zentrum und die Stadt Wadern die Türen des Schlosses etwas weiter für die Allgemeinheit öffnen und die breite Vielfalt der Informatik und deren praktische Anwendungen im Alltag oder in wirtschaftlichen Prozessen vorstellen. Durch einen Impulsvortrag soll ein gemeinsamer Dialog angeregt werden, denn es schließt sich ein gemeinsamer Umtrunk mit Fingerfood an.
Prof. Dr. Ingmar Weber ist Informatikprofessor an der Universität des Saarlandes. Zuvor war er zehn Jahre lang Forschungsdirektor im Bereich Social Computing am Qatar Computing Research Institute (QCRI) in Doha. Seine interdisziplinäre Forschung befasst sich mit der Analyse großer Datenmengen, um gesellschaftliche Phänomene besser zu verstehen. Beispiele sind Untersuchungen zur geschlechtsspezifischen Benachteiligung oder die Abschätzung von Flüchtlingsströmen. 2022 wurde Ingmar Weber eine Alexander von Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz verliehen – Deutschlands höchstdotierter Forschungspreis.
Der Titel seines Vortrags lautet: Von sozialen Medien zu Satelliten: Was Daten für die Gesellschaft verraten
Wir hinterlassen täglich Spuren in Form von Daten, z.B. in sozialen Medien, durch Apps oder sogar beim Unterwegssein mit dem Handy. Auch Satelliten liefern ein immer genaueres Bild unserer Erde - bis hin zu Häusern und Gärten. Solche Daten eröffnen neue Möglichkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen sichtbar zu machen: Wie viele Menschen haben bestimmte Landesteile in der Ukraine verlassen? Wo sind Frauen im digitalen Umfeld benachteiligt? Wie verändert sich unser Mobilitätsverhalten in Hitzewellen? Doch diese Chancen haben Grenzen. Nicht alle Menschen sind digital sichtbar, manche Daten sind verzerrt oder unvollständig. Dadurch können ganze Gruppen übersehen oder falsch dargestellt werden, wodurch Risiken für Politik und Hilfsmaßnahmen entstehen. Im Vortrag werden Beispiele vorgestellt, die zeigen, wie Daten genutzt werden können, um Migration, soziale Ungleichheit oder Umweltveränderungen besser zu verstehen. Gleichzeitig wird gezeigt, wo Gefahren von Fehlinterpretationen oder Missbrauch liegen. Unterstützt wird die Forschung in diesem Bereich durch das neue Großprojekt Societal Observatory Using Novel Data Sources (SOUNDS), das erforscht, wie Daten verantwortungsvoll zum Nutzen der Gesellschaft eingesetzt werden können.
An den Dagstuhler Gesprächen nehmen Entscheider und Gestalter aus Wirtschaft, Politik und an der Informatik teil. Aber auch Interessierte aus der Bevölkerung sind herzlich eingeladen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um vorherige Anmeldung bis zum 24.11.2025 an gespraeche@dagstuhl.de.